Handeln Sie für Sie! Handeln Sie für Ihr Konto!
Direkt | Joint | MAM | PAMM | LAMM | POA
Forex-Prop-Firma | Vermögensverwaltung | Große Privatfonds.
Offizieller Start ab 500.000 US-Dollar, Test ab 50.000 US-Dollar.
Gewinne werden zur Hälfte (50 %) und Verluste zu einem Viertel (25 %) geteilt.
Foreign Exchange Multi-Account Manager Z-X-N
Akzeptiert den Betrieb, die Investitionen und die Transaktionen globaler Devisenkontoagenturen
Unterstützen Sie Family Offices bei der autonomen Vermögensverwaltung
Im Devisenhandel ist die Teilnehmerstruktur komplex. Händler mit unterschiedlichem Kapital und unterschiedlichen Handelsstrategien haben grundlegend unterschiedliche Auftragsabwicklungswege und Positionierungen innerhalb des Brokerage-Systems.
Für Kleinanleger mit geringem Kapital ist folgendes zunächst einmal wichtig: Im aktuellen Forex-Markt-Ökosystem werden Kleinanleger fast zwangsläufig als B-Position-Kunden eingestuft. Diese Einstufung wird nicht durch einen einzelnen Faktor bestimmt, sondern ist das Ergebnis der kombinierten Auswirkungen von Marktregeln, der Gewinnlogik des Brokerage und den Handelseigenschaften des Kleinanlegers.
1. Die „versteckten Eigenschaften“ des B-Position-Mechanismus: Von der Plattform unausgesprochene Handelsregeln.
In der Forex-Branche ist die „B-Position“ ein Konzept, das von Brokern selten öffentlich erwähnt wird. Keine Handelsplattform, ob konform oder nicht, wird in ihren offiziellen Werbematerialien zugeben, dass sie „unsere Kunden in A- und B-Positionen aufteilt und dass Privatanleger zur B-Position gehören“. Der Hauptgrund dafür ist, dass Broker im Wesentlichen als Gegenparteien für Aufträge von Warehouse B fungieren. Das bedeutet, dass die Geschäfte von Privatanlegern nicht direkt mit dem externen Markt (wie etwa mit LP-Liquiditätsanbietern) verbunden sind, sondern innerhalb des internen Handelssystems des Brokers abgewickelt werden.
Aus plattformbetrieblicher Sicht ist dieses „interne Handelsmodell“ sinnvoll: Einerseits kann die Plattform durch die Integration interner Privataufträge die Kosten und Risiken der Verbindung mit externen LPs reduzieren; andererseits ermöglicht das Handelsverhalten von Privatanlegern (wie z. B. hochfrequenter kurzfristiger Handel und geringes Kapital mit geringer Risikotoleranz), dass ihre Aufträge ohne externe Liquidität abgewickelt werden können. Die Plattform legt diesen Mechanismus jedoch nicht offen, um Fragen von Privatanlegern hinsichtlich der Handelsfairness und der tatsächlichen Markteinführung von Aufträgen zu vermeiden und das Image der Plattform als globale Marktanbindung zu wahren.
Zweitens sind Kleinanleger zwangsläufig die drei Haupttreiber von Lager B.
Die Platzierung von Kleinanlegern in Lager B ist keine subjektive Diskriminierung seitens der Broker, sondern eine notwendige Entscheidung auf Grundlage von Risikokontrolle, Kostenrechnung und Rentabilität. Dies lässt sich aus drei Perspektiven analysieren:
(I) Der Konflikt zwischen hohem Hebel und Margin-Anforderungen: Privatanleger haben in Lager A keine Hebeloptionen
Einer der Hauptanreize des Devisenhandels ist ein hoher Hebel. Kleinanleger nutzen häufig Hebel, um ihr Handelsvolumen zu steigern und hohe Renditen mit einer geringen Investition zu erzielen. Würden Privatanleger ihre Orders jedoch in Lager A platzieren (d. h. ihre Orders würden über das STP-Modell an LPs weitergeleitet), bliebe diese Nachfrage völlig unerfüllt. Dies liegt daran, dass vorgelagerte LPs (wie internationale Investmentbanken und große Clearinghäuser) den Brokern strenge Margin-Anforderungen auferlegen. Um eine Kundenorder bei einem LP zu platzieren, müssen Broker einen bestimmten Prozentsatz des Ordervolumens (typischerweise 1–5 %, angepasst an das Risikoniveau des Kunden) an den LP zahlen.
Wenn ein Privatanleger in Lager A platziert wird, muss der Broker für jede Order des Privatanlegers eine Margin hinterlegen. Bei einem Hebel von 100x kann beispielsweise ein Privatanleger mit einem Kapital von 1.000 US-Dollar einen Kontrakt über 100.000 US-Dollar handeln. Der Broker müsste dann eine Margin von 1.000–5.000 US-Dollar an den LP zahlen (berechnet mit einer Margin von 1–5 %). Da das Kapital des Privatanlegers nur 1.000 US-Dollar beträgt, kann der Broker nicht nur nicht die volle Margin vom Privatanleger einziehen, sondern muss auch die Last der Vorfinanzierung tragen, was zu extrem hohen Kapitalkosten führt. Aus Leverage-Sicht haben Privatanleger daher absolut keine Chance, in Lager A einzusteigen.
(II) Gewinnlogik des Brokers: Privatanleger in Lager A können keine Einnahmen für die Plattform generieren.
Das Hauptziel eines Brokers ist die Rentabilität, aber die von Lager A und Lager B erzielten Renditen unterscheiden sich erheblich:
Im Lager A-Modell können Broker nur eine feste Gebühr und einen Spread erheben und müssen die Kosten für Margin-Zahlungen an LPs tragen. Wenn Privatanleger selten handeln und Positionen über lange Zeiträume halten, wird die Gewinnmarge der Plattform weiter reduziert.
Im Warehouse-B-Modell führen die Handelseigenschaften von Privatanlegern (geringes Kapital, kurzfristiger Handel und geringe Risikotoleranz) zu langfristigen Verlusten (Branchendaten zeigen, dass über 80 % der kurzfristigen Händler mit geringem Kapital letztendlich Geld verlieren). Als Gegenpartei können Broker direkt auf die Stop-Loss-Fonds und Margin Calls von Privatanlegern zugreifen und gleichzeitig durch Hochfrequenzhandel höhere Gebühren erzielen – Einnahmen, die die geringen Spreads im Warehouse-A-Modell deutlich übersteigen.
Für Broker ist die Zuweisung von Privatanlegern an Warehouse B eine naheliegende Entscheidung zur Renditemaximierung. Umgekehrt setzt die Zuweisung von Privatanlegern an Warehouse A die Plattform dem doppelten Druck geringer Renditen und Margin-Zahlungen aus, was möglicherweise sogar zu Verlusten führt.
(3) Der grundlegende Bedarf an Risikokontrolle: Privatanleger in Warehouse A verstärken das Plattformrisiko.
Neben Kosten-Nutzen-Überlegungen ist die Risikokontrolle ein weiterer Hauptgrund, warum Broker die Zuweisung von Privatanlegern an Warehouse A ablehnen. LPs unterliegen strengen Anforderungen an die Risikobewertung von Broker-Aufträgen. Wenn Broker eine große Anzahl von Privatanleger-Aufträgen an LPs vergeben, sind sie zwei Hauptrisiken ausgesetzt:
Risiko hoher Volatilität im Privatkundenhandel: Privatanleger verfügen in der Regel nicht über professionelle Handelsstrategien und neigen dazu, aufgrund emotionaler Schwankungen häufig Aufträge zu erteilen und steigenden und fallenden Kursen hinterherzujagen. Dies führt zu geringer Gewinnstabilität und einer hohen Verlustwahrscheinlichkeit. Wenn LPs eine große Anzahl solcher Aufträge annehmen, können konzentrierte Verluste unter Privatanlegern eine Kettenreaktion auslösen, die zu Forderungen nach höheren Margen oder Beschränkungen der Auftragsgröße seitens der Broker führen kann.
Risiko der gesamtschuldnerischen Haftung für Broker: Wenn Privatanleger böswillige Beschwerden einreichen oder sich aufgrund von Verlusten weigern, Verluste zu decken, können LPs die Verantwortung auf die Broker abwälzen und diese zur Deckung der Verlustdifferenz verpflichten. Dies schafft ein zusätzliches ungerechtfertigtes Risiko für Broker und erhöht den operativen Druck weiter. Aus Sicht der Risikokontrolle ist die Zuweisung von Privatanlegern an Lager B durch Broker daher im Wesentlichen eine notwendige Maßnahme zur Isolierung externer Risiken. Durch die interne Auftragsannahme werden die Risiken des Privatkundenhandels auf die Plattform begrenzt, wodurch verhindert wird, dass Privatkundenaufträge die Zusammenarbeit mit LPs beeinträchtigen. Dies reduziert auch die Auswirkungen externer Risiken auf den Plattformbetrieb. III. Die tieferen Gründe, warum etablierte Broker Großkunden in Lager A aufgeben. Während Kleinanleger eindeutig Lager B zugewiesen werden, ist ein bemerkenswerteres Marktphänomen, dass etablierte Devisenbroker weltweit (einschließlich einiger traditioneller Devisenbanken) ihr Großkundengeschäft in Lager A schrittweise aufgeben. Dies hat dazu geführt, dass viele Kontoeröffnungsanträge von Großkunden verzögert und schließlich abgelehnt wurden. Dieses Phänomen spiegelt die Neugewichtung von Risiko und Ertrag durch die Broker wider, die auf drei Hauptfaktoren zurückzuführen ist: (1) Die „geringe Rentabilität“ von Großkunden: Broker haben Schwierigkeiten, Übergewinne zu erzielen.
Die Handelseigenschaften von Large-Cap-Kunden in Lager A sind denen von Privatanlegern völlig entgegengesetzt: Sie verfügen typischerweise über professionelle Handelsteams und ausgefeilte Handelsstrategien, handeln eher langfristig, handeln selten und setzen selten Stop-Loss-Orders um. Dies führt zu äußerst geringen Gewinnen für Broker mit diesen Large-Cap-Kunden:
Geringe Handelsfrequenz: Large-Cap-Kunden halten oft langfristige Positionen, vielleicht nur wenige Male pro Monat. Die von Brokern erhobenen Gebühren und Spreads sind deutlich niedriger als die von Hochfrequenz-Privathändlern.
Geringe Stop-Loss-/Margin-Call-Wahrscheinlichkeit: Large-Cap-Kunden verfügen über großes Kapital und eine hohe Risikotoleranz und sind aufgrund kurzfristiger Marktschwankungen selten zu Stop-Loss-Orders oder Margin-Calls gezwungen. Broker können nicht von „Kundenverlusten“ profitieren.
Starke Verhandlungsmacht: Großkunden haben eine erhebliche Verhandlungsmacht bei Gebühren und Spreads und verlangen von Brokern oft Vorzugskonditionen wie „null Gebühren“ und „niedrige Spreads“, was die Gewinnmargen der Broker weiter schmälert.
Für Broker erfordert die Betreuung von Großkunden erhebliche Investitionen in Personal und Ressourcen (z. B. dedizierte Kundenbetreuer und maßgeschneiderte Handelssysteme), die Renditen sind jedoch deutlich niedriger als bei der Betreuung von Privatanlegern. Dies stellt ein Geschäft mit hohen Investitionen und niedrigen Renditen dar, was es für Broker schwierig macht, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.
(II) Das „hohe Risiko“ von Großkunden: Broker sind dem „Risiko eines Margin Calls“ ausgesetzt.
Obwohl Großkunden sehr risikoresistent sind, bedeutet dies nicht, dass ihr Handel risikofrei ist. Im Gegenteil, die „hohe Kapitalgröße“ kann zu höheren Risiken führen. Wenn Großkunden erhebliche Verluste erleiden, können für Broker „untragbare Verluste“ entstehen.
Das Liquiditätsrisiko bei Großkundenaufträgen: Großkunden können pro Transaktion Millionen oder sogar mehrere zehn Millionen Dollar handeln. Wenn Broker diese Aufträge an Kommanditisten weitergeben, müssen sie sicherstellen, dass diese über ausreichend Liquidität verfügen, um diese Aufträge abzudecken. Bei extremen Marktbedingungen (wie z. B. Black-Swan-Ereignissen) können Kommanditisten Aufträge möglicherweise nicht zeitnah annehmen, was dazu führt, dass Aufträge nicht erfüllt werden und die Broker die Verluste des Kunden tragen. Compliance-Risiken für Großkunden: Die Geldquellen und Handelszwecke von Großkunden sind oft komplexer. Bei Compliance-Problemen wie „unklarer Geldherkunft“ oder „Verdacht auf Geldwäsche“ können Broker von Aufsichtsbehörden untersucht werden und mit schwerwiegenden Konsequenzen wie Geldstrafen und Lizenzentzug rechnen. Im Gegensatz dazu verfügen Privatkunden über kleinere Fonds und geringere Compliance-Risiken, was sie für Broker sicherer macht. Daher ist die Betreuung von Großkunden für Broker gleichbedeutend mit „hohen Risiken für geringe Renditen“, was nicht dem Prinzip der Risiko-Rendite-Anpassung entspricht. Der Verzicht auf diese Geschäftsart ist eine rationale Entscheidung zur Risikovermeidung.
(III) Veränderungen im Marktökosystem: Privatkunden werden zum Mainstream.
Mit der zunehmenden Popularität des Devisenmarktes sind kleine Privatkunden zu den wichtigsten Marktteilnehmern geworden (über 90 %), während die Zahl der Großkunden relativ gering ist (weniger als 10 %). Aus Skaleneffekten können Broker ihre Gewinne maximieren, indem sie ihre Ressourcen auf Privatkunden konzentrieren:
Eine große Anzahl von Privatkunden: Selbst wenn einzelne Privatkunden nur über geringes Kapital verfügen, kann dieser riesige Kundenstamm den Brokern stabile Provisionen, Spread-Einnahmen und Mehrgewinne aus Privatkundenverlusten sichern;
Geringe Betriebskosten: Die Betreuung von Privatkunden kann durch standardisierte Handelssysteme und automatisierten Kundenservice erreicht werden, wodurch erhebliche Investitionen in Einzelkunden entfallen und die Betriebseffizienz verbessert wird;
Intensiver Marktwettbewerb: Inmitten des zunehmend härteren Wettbewerbs in der Devisenbranche verfolgen Broker eine gemeinsame Strategie, um Privatkunden durch niedrige Kontoeröffnungsbarrieren und hohe Hebelwirkung zu gewinnen. Im Gegensatz dazu erfordert die Betreuung von Großkunden den Wettbewerb mit anderen großen Instituten (wie Investmentbanken und Privatbanken), was anspruchsvoller ist und weniger Vorteile bietet.
Aufgrund dieser Faktoren geben große globale Broker ihr Großkundengeschäft mit A-Positionen schrittweise auf und verlagern ihren Fokus auf das Privatkundengeschäft mit B-Positionen, was ein unvermeidlicher Trend in der Entwicklung des Devisenmarktes ist.
Viertens: Schlussfolgerung: Kleinkunden mit geringem Kapital müssen ihre Marktpositionierung rational verstehen.
Für Kleinanleger mit geringem Kapital bedeutet die Klärung ihres „B-Warehouse“-Status nicht „unfaires Handeln“, sondern erfordert vielmehr ein rationales Verständnis der Funktionsweise des Devisenmarktes:
Marktregeln akzeptieren: Das B-Warehouse-Modell ist eine Entscheidung der Broker auf der Grundlage von Risikokontrolle und Gewinnanforderungen und stellt für Kleinanleger auch eine Voraussetzung für den Zugang zu Handelsmöglichkeiten mit hohem Hebel dar.
Vorsicht vor Handelsrisiken: Verluste von Privatanlegern sind im Wesentlichen auf ihre eigenen Handelsstrategien und unzureichende Risikokontrollmöglichkeiten zurückzuführen, nicht auf die gezielte Auswahl der Broker. Sie sollten die Wahrscheinlichkeit von Verlusten durch Verbesserung ihrer professionellen Fähigkeiten und Kontrolle ihrer Handelsfrequenz reduzieren.
Wählen Sie eine konforme Plattform: Obwohl alle B-Warehouse-Plattformen die regulatorischen Vorschriften (wie die Trennung von Kundengeldern und faire Preisgestaltung) strikt einhalten, können sie die Sicherheit der Gelder von Privatanlegern maximieren und die zusätzlichen Risiken vermeiden, die durch das „Market Making“ der Plattform entstehen.
Gleichzeitig spiegeln die Schwierigkeiten von Großkunden bei der Kontoeröffnung auch den Trend zur „Retailisierung“ im Devisenmarkt wider. Die Geschäftsentwicklung der Brokerhäuser zeigt deutlich, dass Privatkunden den Kern des aktuellen Devisenmarktes bilden, während die Bedürfnisse von Großkunden allmählich von professionelleren institutionellen Dienstleistern (wie Privatbanken und Hedgefonds) übernommen werden.
Kurz gesagt: Ob Small-Cap-Privat- oder Large-Cap-Kunde: Nur wenn sie ihre eigene Position am Devisenmarkt und die Geschäftslogik des Brokers genau kennen, können sie rationalere Handelsentscheidungen treffen und Marktrisiken besser managen.
Ein bedauerliches Phänomen im Devisenhandel ist, dass die Wahrscheinlichkeit von Verlusten steigt, je härter ein Trader arbeitet.
Das liegt vor allem daran, dass den meisten Tradern die für kurzfristigen Handel erforderlichen Fähigkeiten und die mentale Stärke fehlen. Tatsächlich fehlt den meisten Anlegern die Fähigkeit zum kurzfristigen Handel, dennoch investieren viele übermäßig viel Zeit und Energie in diesen Bereich.
Die Fallstricke der Marktbeobachtung. Viele Trader sind es gewohnt, den Markt über längere Zeiträume zu beobachten, weil sie glauben, dadurch Marktchancen besser zu nutzen. Diese Vorgehensweise schlägt jedoch oft fehl. Langes Beobachten des Marktes verbessert nicht nur nicht die Erfolgsquote beim Trading, sondern kann sogar impulsives Trading fördern. Angesichts von Kursschwankungen sowie Kontogewinnen und -verlusten lassen sich Trader leicht von Emotionen beeinflussen und treffen irrationale Entscheidungen. Dieses psychologische Phänomen liegt in der menschlichen Natur und lässt sich durch einfache Selbstkontrolle nur schwer überwinden.
Kurzfristiges Trading erfordert nicht nur die Fähigkeit, kurzfristige Kurstrends genau einzuschätzen, sondern vor allem außergewöhnliche mentale Stärke. Angesichts von Marktschwankungen müssen Trader ruhig und gelassen bleiben. Diese mentale Stärke widerspricht jedoch dem menschlichen Instinkt. Den meisten Menschen fällt es schwer, angesichts von Kursschwankungen die Fassung zu bewahren und werden oft von Emotionen beeinflusst. So sind beispielsweise übermäßiges Trading und die häufige Überprüfung von Kontogewinnen und -verlusten Ausdruck menschlicher Instinkte. Diese Verhaltensweisen verstärken sich im kurzfristigen Trading und führen letztlich zu irrationalen Entscheidungen.
Die Risiken des häufigen Tradings. Im Gespräch mit Anlegern, die Verluste erlitten haben, ist mir ein häufiges Problem aufgefallen: häufiges Trading. Diese Anleger fühlen sich oft gezwungen, nach längerer Marktbeobachtung Orders zu platzieren, selbst wenn sie wissen, dass es möglicherweise nicht der beste Zeitpunkt ist. Dieses Verhalten führt direkt zu erhöhten Handelskosten und -risiken, während Gewinne schwer zu garantieren sind. Häufiges Handeln kostet nicht nur Zeit und Energie, sondern kann auch zu übermäßigem Handel führen, was die Verluste weiter verschärft.
Vorschläge für rationales Handeln: Um dieses Dilemma zu vermeiden, können Händler die folgenden Strategien ausprobieren:
1. Reduzieren Sie die Zeit, die Sie mit Marktbeobachtung verbringen: Vermeiden Sie übermäßige Marktbeobachtung, da dies nur impulsives Handeln fördert. Nehmen Sie sich stattdessen täglich etwas Zeit, um Marktstimmung und Trends zu analysieren und einen soliden Handelsplan zu entwickeln.
2. Pending-Order-Handel: Durch die Festlegung angemessener Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte kann der Pending-Order-Handel den Einfluss von Emotionen auf Handelsentscheidungen reduzieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern verhindert auch Fehlentscheidungen aufgrund emotionaler Schwankungen.
3. Konzentrieren Sie sich auf langfristige Analysen: Konzentrieren Sie Ihre Zeit und Energie auf makroökonomische Marktanalysen statt auf kurzfristige Preisschwankungen. Langfristige Trends sind oft leichter zu erfassen als kurzfristige Schwankungen und liegen im Rahmen der Möglichkeiten der meisten Anleger.
4. Vermeiden Sie Vollzeit-Trading: Wenn Ihnen die nötigen Mittel und Fähigkeiten fehlen, sollten Sie nicht versuchen, Vollzeit-Trading zu betreiben. Trading ist nicht einfach und erfordert Fachwissen, Erfahrung und eine starke Denkweise. Vollzeit-Trading erfordert mehr Ressourcen und Vorbereitung und kann Sie höheren Risiken aussetzen.
Beim Devisenhandel müssen Händler ihre eigenen Fähigkeiten und psychologischen Grenzen kennen. Den meisten Anlegern fehlen die für kurzfristigen Handel erforderlichen Fähigkeiten und die mentale Stärke. Daher sollten sie häufiges Handeln und längere Marktbeobachtungen vermeiden. Durch die Reduzierung der Marktbeobachtungszeit, die Annahme ausstehender Orders und die Konzentration auf langfristige Analysen können Händler ihre Emotionen besser kontrollieren, Handelsrisiken reduzieren und eine stabilere Handelsperformance am Devisenmarkt erzielen.
Im Devisenhandel haben Depotverwaltungsdienste aufgrund ihrer Möglichkeit, „Renditen zu erzielen, ohne persönlich tätig werden zu müssen“, große Aufmerksamkeit erregt.
Im aktuellen Marktumfeld weichen die Werbemaßnahmen einiger Depotverwaltungsteams jedoch deutlich vom gesunden Menschenverstand ab, insbesondere in Bezug auf Gewinnversprechen. Diese Behauptungen führen nicht nur Anleger in die Irre, sondern entlarven auch die Unprofessionalität der Dienste selbst. Die rationale Unterscheidung der Legitimität von Gewinnaussagen und die Dekonstruktion der logischen Widersprüche von Hochzinsversprechen sind der Schlüssel zur Risikominimierung für Anleger und bilden die Grundlage für den Aufbau von Vertrauen in die Depotteams.
In der Werbung für Devisendepots sind Renditeversprechen ein wichtiger Anreiz, doch die Rationalität hinter den Renditen, die über verschiedene Zeiträume hinweg angegeben werden, variiert stark. Aus Sicht der Marktprinzipien und des gesunden Menschenverstands ist ein jährliches Renditeversprechen von 20 % zwar hoch, aber theoretisch erreichbar. Dies erfordert vom Depotteam ein ausgeklügeltes Handelssystem, eine strenge Risikokontrolle und das Vertrauen auf langfristige, stabile Markttrends statt auf kurzfristiges Glück. Behauptungen von „20 % monatlicher Rendite“ entziehen sich jedoch jeglicher Anlagelogik, und die damit verbundenen Risiken liegen weit außerhalb der Reichweite von Normalanlegern.
Eine einfache mathematische Berechnung offenbart einen Widerspruch: Erreicht die monatliche Rendite konstant 20 %, würde das Kapital nach einem Jahr auf etwa das 7,4-fache des ursprünglichen Kapitals anwachsen (1,2^12≈7,4), nach zwei Jahren sogar auf das 54,8-fache. Dieses Modell des „exponentiellen Vermögenswachstums in kurzer Zeit“ konnte in reifen Finanzmärkten nie reproduziert werden. Selbst Private-Equity- und Hedgefonds, die für ihre hohen Renditen bekannt sind, können solch übertriebene kurzfristige Renditen nicht erzielen. Noch wichtiger ist, dass der Devisenmarkt von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird, darunter Makroökonomie, Geldpolitik und Geopolitik, was zu höchst unsicheren Preisschwankungen führt. Kurzfristig (z. B. monatlich) einen „stabilen Gewinn von 20 %“ zu erzielen, ist im Wesentlichen gleichbedeutend mit der „kontinuierlichen Vorhersage zufälliger Schwankungen“ und verstößt damit völlig gegen das Risiko-Rendite-Prinzip der Finanzmärkte. Einige Depotverwaltungsteams werben mit ihren Fähigkeiten und behaupten, sie könnten monatliche Renditen von 20 % oder sogar einem Vielfachen davon erzielen. Aus logischer Sicht sind solche Behauptungen jedoch widersprüchlich und halten dem gesunden Menschenverstand nicht stand. Betrachtet man zunächst die Verbindung zwischen Rentabilität und Verhaltenslogik: Wenn ein Depotteam tatsächlich die Kernkompetenz besitzt, einen monatlichen Gewinn von 20 % zu erzielen, besteht sein optimaler Ansatz definitiv nicht darin, regelmäßig Informationen zu veröffentlichen und Online-Marketing zu betreiben. Ein rationaler Entscheidungsansatz sollte die Kombination von Privatkapital mit Geldern von Freunden und Familie priorisieren. Bei einer Anfangsinvestition von 100.000 US-Dollar, die mit 20 % monatlichem Zinssatz verzinst wird, könnte diese nach einem Jahr auf 740.000 US-Dollar, nach zwei Jahren auf 5,48 Millionen US-Dollar und nach drei Jahren auf über 39 Millionen US-Dollar anwachsen und so in nur wenigen Jahren finanzielle Freiheit erreichen. Dieser Prozess macht die Anwerbung externer Kunden überflüssig und schafft Vertrauen durch die Gewinnbeteiligung an Freunden und Familie. Es besteht keine Notwendigkeit, „hochrentierliche Möglichkeiten“ öffentlich bekannt zu geben, noch besteht die Notwendigkeit, das Fondsvolumen durch die Ausschüttung von Gewinnen an externe Investoren zu erhöhen. Denn wer Vermögen aufbauen kann, verwässert durch die Gewinnteilung mit anderen seine eigenen Gewinne, was dem inhärenten Profitstreben des Kapitals widerspricht.
Zweitens sind Versprechen hoher Renditen aus der Perspektive branchenüblicher Benchmarkrenditen noch trügerischer. Weltweit definieren die langfristigen Renditen von Top-Fondsmanagern seit langem die Schwelle zur „Exzellenz“ des Marktes. Spitzenleistungen führen oft zu annualisierten Renditen im Bereich von 20–30 %, was umfangreiche Investment-Research-Teams, ausgefeilte quantitative Modelle und tiefe Einblicke in die globalen Märkte erfordert. Im Gegensatz dazu verfügen herkömmliche Forex-Depotteams nicht über die Ressourcen von Top-Institutionen oder eine nachgewiesene Erfolgsbilanz langfristiger Marktperformance, dennoch versprechen sie „20 % monatliche Rendite“. Die Glaubwürdigkeit ihrer Behauptungen ist daher fraglich.
Für Forex-Depotteams sollte der Hauptzweck der Werbung darin bestehen, „echten Mehrwert zu liefern“ und nicht „Kunden mit falschen Versprechungen anzulocken“. Falsche Werbung für Hochzinsanlagen mag kurzfristig Anleger anziehen, ist aber im Grunde genommen ein „Durstlöscher“. Erstens hält solche Propaganda der Realität nicht stand. Bleiben die tatsächlichen Renditen aus, erkennen Anleger schnell die Wahrheit und fordern nicht nur die Rücknahme ihrer Gelder, sondern können durch Mundpropaganda auch den Ruf des Depotteams schädigen. Zweitens zieht falsche Werbung spekulative Anleger an, denen es an Anlageverstand mangelt. Diese Anleger haben oft ein schlechtes Risikoverständnis, und Verluste können zu Streitigkeiten führen und sogar den normalen Betrieb des Depotteams stören.
Im Gegensatz dazu kann realistische Werbung, auch wenn sie kurzfristig vielleicht weniger ansprechend ist, eine Vertrauensbasis für die langfristige Entwicklung des Depotteams schaffen. Konkret sollte authentische Werbung drei Kernelemente beinhalten: Erstens klare Renditeerwartungen, die Renditeschwankungen nicht verkennen, und die Anleger objektiv darüber informieren, dass historische Renditen keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulassen; zweitens eine transparente Handelslogik, die den Anlegern klar erklärt, woher die Renditen stammen, einschließlich Handelsstrategien, Risikokontrollmaßnahmen und Methoden des Positionsmanagements; und drittens eine überprüfbare Leistungsbilanz, die vollständige historische Handelsdaten liefert (anstatt nur selektiv profitable Aufträge anzuzeigen), mit Daten, die mit Plattformen von Drittanbietern (wie z. B. Forex-Brokern) abgeglichen werden können.
Diese Art der Werbung, die auf gesundem Menschenverstand und Fakten basiert, hilft nicht nur, hochwertige Anleger mit einem rationalen Risikoverständnis zu identifizieren und Streitigkeiten in der späteren Zusammenarbeit zu reduzieren, sondern ermöglicht es dem Depotteam auch, sich auf die Verbesserung seiner Handelsfähigkeiten zu konzentrieren, anstatt falsche Behauptungen aufzustellen. Der Aufbau einer Reputation durch langfristige, stabile Performance schafft einen positiven Kreislauf aus „authentischer Werbung – Gewinnung rationaler Kunden – Leistungsüberprüfung – und Mundpropaganda“.
Gesunder Menschenverstand ist die erste Verteidigungslinie für Anleger und das Endergebnis für Depotteams. Der Kern von Devisendepotdienstleistungen liegt in der Abstimmung von Fachwissen und Anlegergeldern. Die Grundlage für Vertrauen bildet die Abstimmung von Rendite und Risiko. Anleger sollten bei der Werbung für Depots bedenken, dass gesunder Menschenverstand wichtiger ist als Gewinnversprechen. Alle Behauptungen, die die höchste jährliche Rendite von 20 % übersteigen, insbesondere solche mit hohen monatlichen Renditen, sollten mit äußerster Vorsicht betrachtet werden. Durch logisches Denken und den Vergleich mit Branchen-Benchmarks lassen sich Unwahrheiten erkennen. Depotteams müssen sich bewusst sein, dass irreführende Werbung letztlich nach hinten losgeht. Nur wenn sie sich an den gesunden Menschenverstand halten und echten Mehrwert liefern, können sie im hart umkämpften Markt bestehen.
Die langjährigen Gesetze des Finanzmarktes haben längst bewiesen, dass es keine Anlagemöglichkeiten mit geringem Risiko, hoher Rendite und ohne Barrieren gibt. Gewinnversprechen, die dem gesunden Menschenverstand widersprechen, sind von Natur aus irreführend. Sowohl für Anleger als auch für Depotteams gilt: Nur durch die Achtung des gesunden Menschenverstands und des Marktes kann im komplexen Umfeld des Devisenhandels eine nachhaltige Entwicklung erreicht werden.
Im Devisenhandels-Ökosystem bestimmt das Handelsmodell eines Brokers (z. B. STP oder ECN) direkt den Fluss der Anlegeraufträge und die Fairness des Handelsumfelds. Die Wahl zwischen Lager A (Verkaufsauftragsmodell) und Lager B (Wettmodell) ist ein zentrales Kriterium für die Einhaltung der Marktregeln durch einen Broker.
Derzeit behaupten einige Broker, das STP/ECN-Modell zu übernehmen, bedienen aber nur Kunden von Lager B. Dieses Verhalten weicht grundlegend von der Kernlogik des STP/ECN-Modells ab und stellt eher eine formale Nachahmung als eine inhaltliche Konformität dar. Darüber hinaus haben die veränderte Rolle von Privatanlegern und die Erschöpfung der Marktliquidität die Komplexität des Devisenhandelsumfelds weiter verschärft. Dies erfordert eine eingehende Analyse sowohl der Art des Modells als auch der aktuellen Marktsituation.
1. Die Kernlogik des STP/ECN-Modells: Der Auftragsfluss bestimmt die Authentizität des Modells. Um festzustellen, ob ein Broker ein „echtes STP/ECN“-Modell ist, ist es wichtig, zunächst die Kerndefinitionen der beiden Modelle zu verstehen. Ihr Kern besteht darin, „Anlegeraufträge direkt mit dem externen Liquiditätsmarkt zu verbinden“, anstatt „Gewinne durch Wetten gegen Kundenaufträge zu erzielen“.
1. Kernmerkmale eines echten STP/ECN-Modells.
STP-Modell (Straight-Through Processing): Broker leiten Anlegeraufträge (unabhängig von Long- oder Short-Positionen, großen oder kleinen Positionen) automatisch und ohne manuelle Eingriffe über ihre Systeme an Partner-LPs (Liquiditätsanbieter wie internationale Banken, Hedgefonds und Liquiditätsaggregatoren) weiter. Broker selbst beteiligen sich nicht an Kontrahententransaktionen und erzielen Serviceerlöse ausschließlich durch Spreads oder Provisionen. In diesem Modell werden Gewinne und Verluste der Anleger durch tatsächliche Marktschwankungen bestimmt, ohne dass ein direkter Interessenkonflikt mit dem Broker besteht.
ECN-Modell (Electronic Communication Network): Dieses Modell baut einen mehrdimensionalen Liquiditätspool auf und integriert Aufträge mehrerer LPs, institutioneller Anleger und anderer Privatanleger zu einem „Order-Matching-Mechanismus“. Kaufaufträge von Anlegern können direkt mit Verkaufsaufträgen anderer Anleger oder mit Liquiditätsaufträgen von LPs abgeglichen werden. Der Hauptvorteil liegt darin, dass kein Händler eingreift, was zu einer schnellen Auftragsausführung, geringer Slippage und einem grundsätzlich variablen Spread führt, der sich an die Marktliquidität anpasst.
Beiden Modellen ist gemeinsam, dass Broker nicht als Gegenparteien für Kundenaufträge fungieren und die Auftragsabsicherung über externe Liquiditätsmärkte durchführen müssen. Dies unterscheidet sie vom „Market-Maker-Wettmodell (B-Warehouse)“.
2. Der Widerspruch zwischen dem reinen Betrieb eines B-Warehouses und der Inanspruchnahme von STP/ECN. Wenn ein Broker nur Kunden in der B-Position bedient (d. h. alle Kundenaufträge werden vom Broker selbst als Gegenpartei bearbeitet, ohne dass Aufträge an externe LPs vergeben werden), ändert dies nichts an der „wesentlichen Natur des Glücksspiels“, unabhängig davon, wie sehr er das STP/ECN-Modell in Bezug auf Spreads und Provisionen „nachahmt“ (z. B. durch die Festlegung niedriger fester Spreads und die Erhebung geringer Provisionen). Dieser Widerspruch manifestiert sich auf zwei Arten:
Definition des Order Flow Divergence-Modells: Der Kern von STP/ECN ist die Auslagerung von Aufträgen an den liquiden Markt. Im B-Position-Modell werden Kundenaufträge vollständig intern vom Broker abgewickelt – Kundengewinne bedeuten Brokerverluste und Kundenverluste bedeuten Brokergewinne. Dieser Interessenkonflikt widerspricht völlig der Logik des STP/ECN-Modells, die Interessen von Brokern und Kunden in Einklang zu bringen (je aktiver der Kunde, desto höher die Provisionseinnahmen des Brokers). Fehlende Risikoabsicherungsmechanismen: In einem echten STP/ECN-Modell übertragen Broker das Marktrisiko durch den Verkauf von Aufträgen an LPs und tragen dabei nur das operative Risiko ihrer „Channel Services“. Broker, die ausschließlich B-Positionen handeln, tragen hingegen das Marktrisiko aller Kundenaufträge. Bei Gewinnen großer Kunden oder extremen Marktbedingungen sind sie anfällig für Liquiditätskrisen, die möglicherweise dazu führen, dass sie ihre Kundengewinne nicht auszahlen können. Dies kann letztlich zur Schließung der Plattform oder zu Auszahlungsbeschränkungen führen und so die Anlegerrechte verletzen.
Kurz gesagt: „Nur B-Positionen“ und „echtes STP/ECN“ schließen sich gegenseitig aus. Die Authentizität des Modells wird nicht durch oberflächliche Kennzahlen wie Spreads und Provisionen bestimmt, sondern durch das Kernverhalten – ob Aufträge tatsächlich mit dem externen Liquiditätsmarkt verbunden sind.
Zweitens: Erschöpfung der Marktliquidität: Ein Teufelskreis aus veränderten Rollen von Privatanlegern und einem sich verschlechternden Handelsumfeld.
Das aktuelle Problem der nahezu erschöpften Liquidität am Devisenmarkt ist kein Zufall, sondern die unvermeidliche Folge der veränderten Rolle von Privatanlegern und der unausgewogenen Marktbeteiligungsstruktur. Diese Verschiebung verändert nicht nur die Marktvolatilität, sondern drückt auch die Gewinnmargen von Privatanlegern weiter. Dadurch entsteht ein Teufelskreis aus reduzierter Liquidität – geringer Volatilität – Rückzug von Privatanlegern – weiterer Liquiditätsreduzierung.
1. Privatanleger mit geringem Kapital: Wandel von „Handelsteilnehmern“ zu „passiven Liquiditätsanbietern“.
Im traditionellen Devisenmarkt wird Liquidität hauptsächlich von Kommanditisten (LPs) wie großen internationalen Banken und Liquiditätsaggregatoren bereitgestellt. LPs sorgen für stabile Marktpreisschwankungen, indem sie kontinuierlich Preise stellen und große Aufträge annehmen, während Privatanleger von diesen Schwankungen profitieren. In den letzten Jahren hat sich die Rolle der Privatanleger jedoch im Zuge des veränderten Marktumfelds schrittweise umgekehrt:
LPs haben sich schrittweise aus dem Devisenmarkt für Privatanleger zurückgezogen. Aufgrund von Faktoren wie der Verschärfung globaler Regulierung (wie der MiFID II der EU und der ASIC-Vorschriften Australiens) und der zunehmenden Volatilität der Devisenmärkte (wie den Zinserhöhungen der US-Notenbank und geopolitischen Konflikten) haben große LPs ihre Risikobereitschaft im Devisenmarkt für Privatanleger reduziert und ihr Liquiditätsangebot an kleine und mittelgroße Broker schrittweise reduziert, was zu einem Rückgang der externen Liquidität im Markt führte.
Privatanlegeraufträge werden zwangsläufig zu „Liquiditätsergänzungen“: Wenn die externe Liquidität der LPs nicht ausreicht, gleichen einige Broker, um die Effizienz der Auftragsausführung aufrechtzuerhalten, Privatanlegeraufträge intern ab – sie gleichen einen Kaufauftrag von Privatanleger A direkt mit einem Verkaufsauftrag von Privatanleger B ab, wodurch die Notwendigkeit externer Aufträge entfällt. In dieser Situation handeln Privatanleger nicht mehr über Liquidität, sondern stellen dem Markt Liquidität zur Verfügung. Ihr Handelsverhalten wird effektiv zur Gegenpartei anderer Anleger, was ihre Gewinnmargen erheblich schmälert.
Noch wichtiger ist, dass Kleinanleger mit geringem Kapital oft nicht über professionelle Fähigkeiten zur Risikokontrolle und Trendanalyse verfügen. In ihrer Rolle als „passive Liquiditätsgeber“ sind sie anfälliger für Verluste aufgrund zufälliger Marktschwankungen oder Brokerage-Matching-Regeln (wie Slippage und verzögerte Ausführung). Dies kann zu der Annahme führen, dass „je mehr man handelt, desto mehr verliert man“, was sie letztendlich zum Ausstieg aus dem Markt führt.
2. Die direkte Folge der Liquiditätsverknappung: Marktschwankungen werden „still“, und Trendchancen verschwinden.
Devisenmarktschwankungen werden grundsätzlich durch ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage getrieben. Wenn große Kapitalmengen in Long- oder Short-Positionen auf ein Währungspaar konzentriert sind, entwickelt der Preis einen klaren Trend (z. B. einen einseitigen Anstieg oder Rückgang), der Kleinanlegern eine wichtige Gewinnchance bietet. Mit dem Ausstieg von Kleinanlegern und der sinkenden Liquidität der Kommanditgesellschaften gleichen sich Angebot und Nachfrage am Markt jedoch allmählich aus. Dies äußert sich wie folgt:
Kurzfristige Schwankungen werden fragmentiert: Die Preise weisen keinen kontinuierlichen Trend mehr auf, sondern schwanken wiederholt innerhalb einer engen Spanne mit extrem geringen Schwankungen (z. B. schwankt der EUR/USD-Kurs täglich nur um 30–50 Pips). Selbst wenn Privatanleger diese Schwankungen ausnutzen können, fällt es ihnen schwer, Transaktionskosten wie Spreads und Provisionen zu decken, was ihre Rentabilität deutlich erhöht.
Verschwinden von Trendmärkten: Ohne die treibende Kraft von Großkapital (wie Institutionen und Kommanditgesellschaften) fällt es dem Markt schwer, nachhaltige, einseitige Bewegungen zu bilden. Dies kann sogar zu „falschen Ausbrüchen“ und „Schockwellen“ führen, die Privatanleger zusätzlich in die Irre führen. Beispielsweise kann es so aussehen, als würde ein Währungspaar ein wichtiges Widerstandsniveau durchbrechen, doch in Wirklichkeit handelt es sich um eine kurzfristige Schwankung, die von einer kleinen Anzahl von Privataufträgen angetrieben wird, gefolgt von einem rapiden Rückgang, wodurch Privatanleger, die ihren Aufträgen nachjagten, in die Falle gelockt werden.
Dieses ruhige Marktumfeld verstärkt wiederum den Ausstiegsdrang von Kleinanlegern. Da sie nicht von Trendschwankungen profitieren können und die Transaktionskosten hoch bleiben, werden die meisten Kleinanleger den kurzfristigen Handel aufgeben. Gleichzeitig zögern neue Kleinanleger aufgrund von Gerüchten, dass es „keine Marktchancen“ gebe, in den Markt einzusteigen. Dies führt letztlich zu einer weiteren Verknappung der Marktliquidität und einem Teufelskreis zyklus.
III. Reaktionen von Investoren und Aufsichtsbehörden: Von der Mustererkennung zur Umweltverbesserung.
Angesichts der Verzerrung von Brokermodellen und der Marktliquiditätskrise müssen Investoren ihre Risikoerkennungsfähigkeiten verbessern, und die Aufsichtsbehörden müssen die Marktregulierung stärken, um gemeinsam ein rationales Devisenhandelsumfeld zu fördern.
1. Investoren: Durchdringen Sie das Brokermodell und bewerten Sie das Handelsumfeld rational.
Überprüfen Sie die Authentizität der Auftragsflüsse: Fordern Sie bei der Auswahl eines STP/ECN-Brokers eine „Liquiditätsverbindungszertifizierung“ an (z. B. eine Kooperationsvereinbarung mit LPs und Auftragsausführungsberichte) oder nutzen Sie Tools von Drittanbietern (z. B. Software zur Erkennung von Auftragsausführungsverzögerungen), um zu überprüfen, ob „innere Übereinstimmungsspuren“ vorliegen (d. h., Kauf- und Verkaufsaufträge sind gleichzeitig perfekt abgestimmt, ohne den Einfluss externer Marktschwankungen).
Vorsicht vor der Falle „Niedriger Spread + Nur B-Position“: Wenn ein Broker behauptet, ein „STP/ECN-Modell“ anzubieten, aber nur ein B-Position-Konto anbietet und der Spread deutlich unter dem Marktdurchschnitt liegt (z. B. 0,1–0,3 Pips beim EUR/USD), sollten Sie äußerst vorsichtig sein. Diese „niedrigen Kosten“ sind im Grunde eine „Verlockung zum Wetten“. Übersteigen die Kundengewinne die Kapazitäten des Brokers, kann es zu Serviceeinschränkungen oder Risiken für die Fondssicherheit kommen.
Passen Sie Ihre Handelsstrategien an die Marktbedingungen an: Vermeiden Sie in Märkten mit schwindender Liquidität hochfrequenten kurzfristigen Handel (wie Scalping) und verfolgen Sie stattdessen eine mittel- bis langfristige Handelsstrategie. Durch die Analyse makroökonomischer Daten (wie Zinsentscheidungen und BIP-Daten) zur Identifizierung langfristiger Trends können Sie die Auswirkungen kurzfristiger Schwankungen auf Ihren Handel abmildern.
2. Regulierungsbehörden: Verstärken Sie die Compliance-Aufsicht über Handelsmodelle und fördern Sie die Entwicklung eines liquiden Marktes.
Klare regulatorische Standards für das STP/ECN-Modell: Die Regulierungen definieren die Kernelemente eines echten STP/ECN-Modells (wie Order-Out-Ratios, LP-Partnerqualifikationen und Transparenz der Auftragsausführung). Broker, die angeblich STP/ECN-Dienste anbieten, aber nur B-Positionen-Handel anbieten, werden mit Strafen belegt, um Modellbetrug zu verhindern.
LPs zurück in den Privatkundenmarkt führen: Politische Unterstützung (wie die Straffung von Compliance-Prozessen und die Reduzierung der Risikoreserveanforderungen) wird große internationale LPs dazu ermutigen, mit konformen Brokern zusammenzuarbeiten, um die Marktliquidität wiederherzustellen. Gleichzeitig wird die Entwicklung von Liquiditätsaggregationsplattformen gefördert, um Multi-Channel-Liquiditätsressourcen zu integrieren und die Effizienz der Marktauftragsausführung insgesamt zu verbessern.
Intensivere Anlegeraufklärung: Über offizielle Plattformen werden wir Privatanleger über die wesentlichen Unterschiede zwischen A-Position/B-Position und STP/ECN sowie den Zusammenhang zwischen Marktliquidität und Gewinnchancen informieren. Dies hilft Privatanlegern, eine rationale Anlageperspektive zu entwickeln und Handelsfallen zu vermeiden, die durch „Modellmissverständnisse“ oder die Verlockung hoher Renditen entstehen.
Modellauthentizität und ausreichende Liquidität sind die beiden Säulen eines gesunden Devisenmarktes. Der Kernwert des bidirektionalen Devisenhandels liegt darin, Anlegern die Möglichkeit zu bieten, durch Marktschwankungen Wertsteigerungen zu erzielen. Die Realisierung dieses Werts beruht auf zwei Voraussetzungen: der Authentizität des Brokerage-Modells (STP/ECN muss tatsächlich mit externer Liquidität verbunden sein) und ausreichender Marktliquidität (ausreichend Mittel, um Trendschwankungen zu steuern). Die derzeitige Praxis einiger Broker, STP/ECN-Modelle zu imitieren und nur den Handel mit B-Positionen anzubieten, in Verbindung mit der aktuellen Situation schwindender Marktliquidität, verletzt nicht nur die Anlegerrechte, sondern untergräbt auch das Vertrauen in den Devisenmarkt.
Für Broker ist eine langfristige Entwicklung nur möglich, wenn sie sich an die Grundvoraussetzung der „Modellkonformität“ halten und rationale Investoren durch authentische STP/ECN-Dienste gewinnen. Anleger müssen ihr Fachwissen nutzen, um Modellfehler zu erkennen und rational auf Marktveränderungen zu reagieren. Regulierungsbehörden wiederum müssen institutionelle Rahmenbedingungen schaffen, um die Marktordnung zu regulieren und die Wiederherstellung des Liquiditätsökosystems zu fördern. Nur durch die koordinierten Bemühungen dieser drei Parteien kann der Devisenmarkt zu seinen Grundprinzipien von Fairness, Transparenz und Effizienz zurückkehren und ein nachhaltiges Handelsumfeld für alle Teilnehmer schaffen.
Im Devisenhandel müssen sich Anleger darüber im Klaren sein, dass Expert Advisors (EAs) kein Allheilmittel sind und nicht vollständig an die Komplexität des Devisenmarktes angepasst sind.
Trotzdem erscheint häufig Werbung für EAs. Dies könnte daran liegen, dass Devisenmakler und -broker das Schlüsselwort „EA“ als getarntes Marketinginstrument verwenden, um mehr potenzielle Kunden zu gewinnen.
Im Devisenhandel sind die meisten kurzfristigen Händler Kleinanleger mit geringem Kapitaleinsatz. Diese Gruppe ist oft die Hauptursache für Verluste. Kurzfristiger Handel ist naturgemäß anspruchsvoll, und die Gewinnchancen sind relativ begrenzt. Wenn Kleinanleger Schwierigkeiten haben, Gewinne zu erzielen, suchen sie oft nach neuen Methoden und Tools, um ihre Handelsleistung zu verbessern. EAs rücken dabei in den Fokus. Forex-Agenten und -Broker nutzen dies aus und bewerben EAs, um Kleinanleger für die Eröffnung von Handelskonten zu gewinnen und so für Marktverkehr zu sorgen.
Wenn EAs jedoch tatsächlich stabile Gewinne erzielen können, entscheiden sich EA-Anbieter eher dafür, sie selbst zu handeln, um die Gewinne einzustreichen, anstatt sie zu verkaufen. Diese Logik ist einfach und offensichtlich und verdient von jedem Anleger sorgfältige Beachtung.
 13711580480@139.com
13711580480@139.com
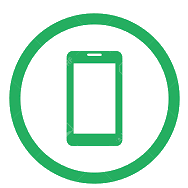 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 z.x.n@139.com
z.x.n@139.com
 Mr. Z-X-N
Mr. Z-X-N
 China · Guangzhou
China · Guangzhou



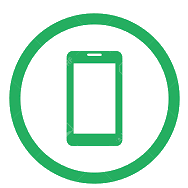 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 +86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
 Mr. Z-X-N
Mr. Z-X-N
 China · Guangzhou
China · Guangzhou